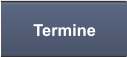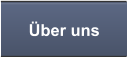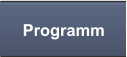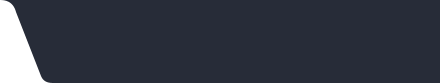


Über uns


COHORS IIII VINDELICORUM
Der geschichtliche Hintergrund
Herkunft der 4.Vindeliker-Kohorte
Die Vindeliker waren ein keltischer Volksstamm aus der Gegend um Augsburg (Augusta Vindelicum), dessen Krieger ursprünglich als Hilfstruppen ausgehoben und rekrutiert wurden. Die ca. 500 Mann starke 4. Vindeliker-Kohorte ist zunächst in Nida (Frankfurt-Heddernheim) nachweisbar und wurde im frühen 2. Jahrhundert in dem ca. 2,2 ha großen Kastell von Großkrotzenburg stationiert. Im 2. Jahrhundert wird zwar der traditionelle Name der Vindeliker-Kohorte weitergeführt, aber die Soldaten sind nun schon längst romanisierte Provinzbewohner.Das Kastell von Großkrotzenburg
In Großkrotzenburg trifft der Taunus-Wetterau-Limes auf den Main, um hier als "nasse Grenze" weiterzuführen. Die wichtige Funktion als Umschlagplatz für Warengüter wird durch eine Brücke über den Main und eine Benifiziarier-Station (mit Polizei- und Zollaufgaben) unterstrichen. Die Gründung des Kastells wird gegen Ende des 1. Jahrhunderts vermutet. Die nicht nachgewiesene Holzkonstruktion wurde ca. ab 130 n. Chr. durch einen massiven Steinbau ersetzt, von dem noch Bebauungsreste vorhanden sind und dessen Lageplan sich heute noch im Stadtbild und der Straßenführung erkennen lässt.Auxiliare - Soldaten 2. Klasse?
Die Kastelle und Wachtürme am Limes wurden ausschließlich von Hilfstruppen, sogenannten Auxiliareinheiten, besetzt. Im Gegensatz zu den Legionären besaßen die meisten Auxiliarsoldaten anfänglich kein Bürgerrecht und waren daher gesellschaftlich unterprivilegiert. Der Dienst in der Armee war eine Möglichkeit des Aufstiegs, denn neben einer hohen Abfindung wurde dem Soldaten zur Entlassung nach 25 Jahren Dienstzeit auch das Bürgerrecht verliehen. Grundsätzlich wurden alle spezialisierten Kampfverbände, die man aus besetzen Gebieten und von besiegten Völkern rekrutierte, als Hilfstruppen geführt, z.B. die gallische oder germanische Kavallerie, syrische Bogenschützen, Schleuderer aus dem Mittelmeerraum oder schwere Panzerreiter aus dem Orient.Die Römer im Rhein-Main Gebiet
Nach den Rückschlägen durch die Varusschlacht im Jahre 9. n. Chr. hatten die Römer ihre Bestrebungen zur Eroberung Germaniens weitgehend eingestellt. Erst Domitians Feldzug gegen die Chatten in den 80er Jahren führte zur Besetzung des obergermanischen Gebietes und zur Einrichtung der Grenzlinie, die später als Limes bezeichnet wurde. Die neue Grenze wurde durch eine provisorische Kette von Kastellen und Wachtürmen gesichert, die in dieser frühen Bauphase meist aus Holz bestanden. Unter Hadrian werden ab 117 n. Chr. die Grenzbefestigungen zunehmend verstärkt, der Limes erhält eine Holzpalisade und die alten Holzkastelle werden wegen einer Korrektur der Limeslinie entweder aufgelassen (Mittelbuchen, Heldenbergen, Salisberg) oder sukzessive durch massive Steinbauten ersetzt. Als militärische Befestigung war der Limes trotz des engen Netzes von Wachtürmen und Kastellen ungeeignet. Durch eine geschickte römische Bündnispolitik, Klientel, Warenaustausch und militärische Kontrolle des Vorlandes war die Gefahr eines großangelegten Angriffes zumindest bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts auch nicht gegeben. Zur Abwehr von kleinen Räubertrupps (Latrones) und für wirtschaftliche Zwecke, d.h. zur Kontrolle des Waren- und Personenverkehrs, hat sich der Limes aber über eine lange Zeit hinweg bewährt.
© Markus Neidhardt, Bilder COH IIII VIND, Jacques Maréchal (http://www.pixures.be)